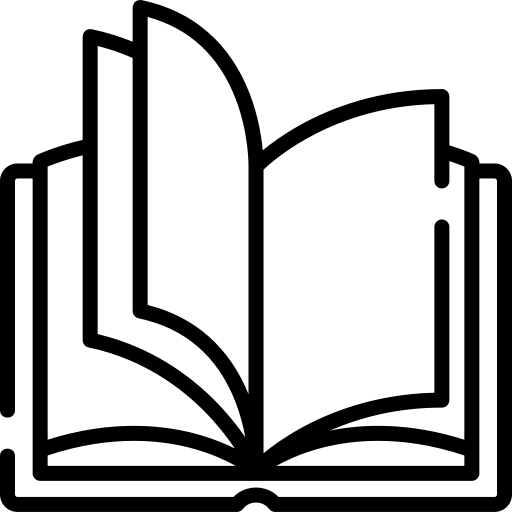Glander, Silvia
Silvia Glander
*1944
Vorsitzende und Präsidentin des TV Ratingen 1865 e. V.
38 Jahre lang wirkte Silvia Glander als ehrenamtliche Impulsgeberin für die Professionalisierung und Wachstumsdynamisierung des TV Ratingen. Auch im Vorstand des Freiburger Kreises engagierte sich die Personalreferentin (nicht nur) für die Interessen ihres Großsportvereins.
Kurzbiografie
- Geboren 1944 in Oldenburg i. O.
- 1960-1963 Ausbildung zu Industriekauffrau
- 1963-2009 Personalreferentin/Personalbetreuerin bei der Mercedes-Benz AG
- Seit 1983 Mitglied im TV Ratingen
- 1985-2006 Leiterin der Schwimm-Abteilung im TV Ratingen
- 1991-2008 Stellv. Vorsitzende des TV Ratingen
- 1994-2004 Mitglied und stellv. Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Ratingen
- 1996-2011 Vorstandsmitglied (bis 2003) und danach Vorstandsvorsitzende des Freiburger Kreis e. V. (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Großsportvereine)
- 2004-2020 Sportpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Ratingen
- 2009-2015 Erste Vorsitzende des TV Ratingen
- 2015-2021 Präsidentin des TV Ratingen
- 2021 Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen
Silvia Glander über …
-
… ihren Einstieg in den TV Ratingen
„Den Verein habe ich anfangs gar nicht als Verein wahrgenommen. Unsere Tochter wurde zum Schwimmen angemeldet, und dort gab es die Schwimmer und einen Abteilungsleiter, der das organisierte. Zum Verein selbst hatte ich zunächst kaum Kontakt. Wir haben uns einfach um den Sport gekümmert, mehr nicht. Es begann mit der Ausbildung, dann kamen Fördergruppen und Leistungsgruppen, und ab da wurden natürlich auch die Eltern stärker eingebunden, man war öfter dabei und hatte mehr Kontakt. Da ich gut organisieren konnte, bot sich an: ‚Wer macht was?‘ – und ich sagte: ‚Ich mache das.‘ So begann ich, in der Abteilung mitzuorganisieren. Als der Abteilungsleiter dann aufhören wollte und wir uns gut verstanden, arbeiteten wir zusammen, und so bin ich langsam in den Verein hineingewachsen. Es gab ein Gespräch mit dem Vorstand, das war damals noch eine ganz andere Welt als heute.
Es gab keine hauptberuflichen Mitarbeiter, nur eine Halbtagskraft für die Mitgliederverwaltung. Die Devise war: ‚Hast du Ideen? Kennst du jemanden, der mitmacht? Dann mach es!‘ So funktionierte der Vorstand damals. Wenn man mit dem Vorstand sprach und sagte: ‚Ich habe eine Idee oder möchte eine neue Gruppe gründen,‘ hieß es: ‚Ja, wenn du Übungsleiter hast und es finanziell passt, dann kann man das machen.‘ Das galt für alle Sportarten, Schwimmen, Handball, Leichtathletik – alles ehrenamtliche Abteilungsleiter oder Übungsleiter, die für wenig Geld arbeiteten, sechs, sieben DM die Stunde.
Es gab eine Startgemeinschaft mit einem anderen Verein, wobei auf Ebene der Aktiven keine Probleme bestanden. Probleme gab es erst auf Vorstandsebene, etwa wenn einer nicht zahlte, was mich damals nicht weiter beschäftigte, solange alles lief. Als ich aber Verantwortung übernahm und den Verein bewusster wahrnahm, wurde klar, was nicht funktionierte. Für einen reibungslosen Ablauf musste sich etwas ändern. Damals hatte der Verein etwa 1200 bis 1300 Mitglieder, und der Vorstand entschloss sich schließlich, die erste hauptamtliche Kraft einzustellen: Marion Weißhoff-Günther.“
-
… die Entwicklung des TV Ratingen
„Ratingen ist 1975 als Stadt von vielen Gemeinden im Rahmen der Umgliederungen zur Stadt geworden. Da gab es sieben kleine Dörfchen, die vorher selbstständig waren, die 1975 eingemeindet wurden. In den vier größeren gab es auch Sportvereine, das waren keine Großvereine wie der TV. Der TV war und ist auch jetzt immer noch der größte Verein. Jetzt haben wir 6200 Mitglieder, und in den anderen Ecken, in Hösel zum Beispiel oder Lintorf und Ratingen-West, da gibt es Vereine, mit denen man gut zusammenarbeitet, die kleiner sind, aber nie Konkurrenten, weil die auch in ihrer Kirchturmsecke zu Hause sind. Das Kirchturmdenken hat nie aufgehört und ist seit 1975 unverändert. Die Rathäuser wurden zwar abgeschafft in den einzelnen Dörfern, aber ansonsten ist das immer noch Hösel, Lintorf, West, Homberg, wie auch immer, das bleibt.
Und die Vereine, die da sind, die sind auch gut aufgestellt. Da ist einer, der hat auch über 3000 Mitglieder, aber die anderen sind so bei 2000 geblieben. Wir sind so eine Gruppe Großvereine und haben dann später angefangen, uns auch mal zu treffen. Da der Sportverband in der Stadt sehr schwierig zu steuern war oder sich auch schwierig gekümmert hat, wie das damals mit der Sportpolitik so war. Den Stadtsportverband gab es zwar, aber man hat ihn nicht gemerkt. Und da haben wir dann mit diesen fünf Vereinen eigentlich angefangen, Sportpolitik zu machen. Das war aber auch erst Ende der 90er Jahre, wo wir da aktiv geworden sind.
Bis dahin haben wir uns erst mal selbst aufgestellt, und Anfang der 90er Jahre sind wir zum Freiburger Kreis. Bis dahin haben wir uns so aufgestellt, dass wir eine Struktur hatten, dass wir mit den Hauptberuflichen gut arbeiten konnten, die wurden nachher auch noch zu Fachbereichsleitern. Die Ehrenamtlichen waren irgendwann nicht mehr zu finden. Auch da hat sich ja die Zeit geändert. Die Frauen wurden berufstätig, die Männer waren im Sport beim Handball und Fußball vielleicht, aber mehr auch nicht. Und da musste man gucken, dass man diese Abteilungen mindestens hauptberuflich begleitet und dann einen Verantwortlichen in der Abteilung hat. Dem konnte man dann nicht mehr die ganzen Aufgaben abnehmen. Dazu gehörte auch die Verbandsarbeit, und wie wir wissen, gab es für jede Abteilung wieder Meldungen, die wir machen müssen. Das hat dann die Hauptberuflichkeit übernommen und auch dafür gesorgt, mal neue Trainer und neue Übungsleiter zu finden. Also da hat die Hauptberuflichkeit sehr viel dazu getan, dass das funktioniert. Sie hat auch den Sport selber begleitet, Veränderungen mit eingeführt und immer wieder nebenher auch das Thema Immobilien.
Wir haben 1989 das Sportstudio gebaut. Wir haben 1984 einen eigenen Kindergarten aufgebaut und in diesem Haus noch mal ein Studio entwickelt. Wir haben dann 2004 in einem anderen Stadtteil ein großes Studio gebaut. Also wir waren immer wieder mit Baumaßnahmen beschäftigt. Wir haben uns immer abends zu Besprechungen getroffen, um das Ganze auch auf den Weg zu bringen. Wir hatten Architekten, wir hatten Handwerker, die brauchen das Geld. Das war immer das Schlimmste, bei der Verwaltung das Geld zu bekommen. Sie müssen ja erst mal sagen, was sie wollen. Dann müssen sie die Politiker überzeugen. Das heißt, ich bin dann teilweise alleine oder auch mit der Marion zusammen von einer Partei zur anderen gefahren, sind dann in die Fraktionsrunden und haben dann fest vorgestellt, was wir vorhaben. Bis wir dann das Geld hatten, hat es natürlich auch wieder gedauert. Natürlich auch mit unserem Vorsitzenden, der in der FDP aktiv war, und ich war in der CDU aktiv. Also da haben wir beide unseren Weg aufgenommen, und es hat bis jetzt immer dazu geführt, dass wir auch Erfolg hatten.
Der Kindergarten kam dazu. Das war am Anfang schwierig mit den Verhandlungen im Landschaftsverband, da fehlten uns vier Quadratmeter, um die genehmigte Fläche für den Kindergarten zu bekommen. Da haben wir hin und her geschoben, damit wir die vier Quadratmeter kriegen. Heute, glaube ich, haben sie Kindergärten in jeder Wohnung, da fragt kein Mensch mehr, ob die Quadratmeter reichen, weil der Bedarf so groß ist. Aber wir haben uns als anerkannter Sport- und Bewegungskindergarten auch selber verwalten können. Wir haben unsere Beiträge selbst festgesetzt für die Kinder. Die Eltern haben für den Sport auch relativ viel bezahlt. Wir sind dann Anfang der 2000er Jahre, 2005 oder 2006, übergangen in die Verwaltung durch die Stadt, wobei wir immer noch selbstständig sind bei dem, was wir machen dürfen. Nur bei den Aufnahmen der Kinder sind natürlich jetzt auch die Meldungen von der Stadt dabei. Aber das läuft hervorragend. Die Eltern zahlen immer noch ihren Beitrag für den Sport zusätzlich zum normalen Beitrag. Und jetzt wird bei uns nicht gestreikt. Ich meine, das muss man einfach auch wissen. Das wissen die Eltern auch zu schätzen.“
-
… Schwimmen für muslimische Frauen
„Ich habe Schwimmen für muslimische Frauen eingerichtet. Das war ein harter Job. Es kam eine Muslima und sagte: ‚Wir haben zwar Wasserzeiten, aber ich kriege das nicht richtig gebacken mit dem Training und mit den Stadtwerken, denen ja das Bad gehört.‘ Die hatten sich beschwert, dass es so schlimm ist und da im Bad gegessen wird, und Hygiene sei für die ein zweites Wort. Und dann habe ich auch so gedacht, ja, gucken wir mal!
Und die habe ich dann auch zum Gespräch gebracht und habe aber gemerkt, dass sie eigentlich mit ihrem Verein, ‚Islamischer Sport und Kultur‘ hieß der, also dass sie mit ihrer Gruppe so in unseren Verein wollte.
Und dann haben wir gesagt, das geht nicht. Wir sind ja für Integration, die habe ich mir da ganz anders vorgestellt, aber trotzdem haben wir ein Stück Integration erreicht. Ich habe gedacht, wenn ich dann deutsche Frauen finde, die schwimmen möchten, und muslimische, das wäre doch eine nette Ecke, das ist nichts geworden.
Erst mal wollten die deutschen Frauen nicht. Da habe ich nur eine gefunden, die mir zuliebe mal da schwimmen gegangen ist. Und ansonsten wollten sie die Muslime auch unter sich lassen. Die Frau, die da zunächst mal sehr nett war, ist dann sehr extrem geworden und hat sich beklagt, dass unsere Übungsleiterin in kurzer Hose am Beckenrand stehen würde. Also bin ich jede Woche erst mal mit ins Bad und habe mir das angeguckt. Die brachten dann Essenskörbe mit, weil sie ja auch ein paar Kinder noch dabei hatten. Das geht überhaupt nicht. Die mussten sich ausziehen, umkleiden, Badezeug anziehen.
Das war am Anfang nicht unseren Vorstellungen entsprechend. Dann haben die sich beklagt. Es tagten dann in Ratingen die drei Imame von Ditib und wie die anderen so heißen und unser Dezernent und haben dann dort geklärt, ob es so laufen kann. Ja, die Imame waren damit einverstanden, dass unsere Übungsleiterinnen so am Beckenrand stehen, aber die Frauen haben immer noch nicht aufgegeben.
Dann habe ich alle angeschrieben, Merkel, den Landessportbund, die Landesregierung in Hannover, dort war seinerzeit eine türkische Ministerin. Ich habe also alle angeschrieben, was die denn davon halten. Wir wollten Integration und meine Integration habe ich dann damit begründet, dass man Menschen eingliedert ins Vereinswesen: Überhaupt mal Mitglied im Verein zu sein, jeden Monat Gebühren zu zahlen und dann auch pünktlich zu kommen und zu gehen und sich an die Vorschriften zu halten, die der Verein hat. Das war für mich das Ergebnis der Integration.
Also die haben dann auch alle geantwortet und wir sind mit diesem Iman und so übereingekommen, wir machen das so, wie wir das für richtig halten. Da braucht keine einen Burkini oder sonst was. Und das ging gut. Die eine Frau hat dann noch gesagt, wenn sie nicht wäre, wäre eine andere Frau ertrunken. Dann habe ich sie rausgeschmissen, weil das nicht stimmte. Die hat dann auch irgendwann Ruhe gegeben und seitdem lief das eigentlich wirklich toll. Wir haben dann zweimal im Jahr dafür gesorgt, dass im Foyer des Sportbads, da war sonst keine andere Gruppe mehr, die Frauen sich treffen konnten und jeder brachte was Gekochtes mit. Das war eine wunderbare Runde. Die haben Rezepte ausgeteilt. Es waren ja nicht nur Türken, die waren ja aus Marokko, aus Algerien, aus der Türkei. Es war ja eine ganz bunte Runde da. Und wir hatten in der Hochzeit an die 75 Anmeldungen, und leider ist das mit Corona jetzt verschwunden.
Aber das war in der Form Integration, für die war es im Verein super. Einige haben dann gesagt, wenn sie die Anmeldung unterschreiben sollten: ‚Nein, mein Mann hat gesagt, ich darf nicht unterschreiben.‘ Dann hat man gesagt: ‚Nehmen Sie es mit und machen das zu Hause.‘ Das sind ja alles Dinge, die man regeln kann.
Die Kinder kamen dann später nicht mehr mit. Wir haben dann unterteilt in Schwimmausbildung, Aqua-Jogging und dann das normale Schwimmen im Becken, und das war für die Frauen völlig okay und das war auch wirklich eine tolle Sache. Jetzt steht das Wasser leider nicht mehr zur Verfügung, schade, das hat Corona auch geopfert.“ -
… Kooperationen mit Schulen und Eröffnung des Sportstudios
„Die Schulen sind ein ganz großes Problem, weil die Schulen eigentlich immer glauben, sie brauchen die Vereine nicht. Wir haben angefangen mit einer Schule, und diese Kooperation läuft eigentlich immer. Wir haben dort einen unserer Sportlehrer abgestellt zum Sportunterricht. Und die Schule hat dafür eine Lehrerstelle in diese Stundenangebote von uns umgewidmet. Das hat jahrelang gut funktioniert. Im Volleyball zum Beispiel hatten wir dann auch in dieser Schule eine Mannschaft, die dann auch gestartet ist. Also das war eine gute Entwicklung. Heute etwas eingeschlafen, mehr oder weniger aus Zeitgründen und weil auf dieser Schule auch gerade neu gebaut wird. Es sind zu viele Kinder, sodass dann überhaupt nicht mehr richtig zu steuern ist, wer geht jetzt in diese AG, um das zu machen? Aber noch läuft sie, und noch gibt es diese Sportangebote. Aber es ist nicht mehr diese Stärke, die sie mal hatte, wirklich einen Vormittag Sportunterricht in der Schule und verschiedene Angebote zu geben.
Also die Kooperation läuft noch, aber sie ist nicht mehr so ausgefüllt. Wir haben einen Sportlehrer an eine Schule vermietet, weil es da gerade keinen Sportlehrer gab. Der hat dann auch Sportunterricht mitgemacht, und das ist dann entsprechend abgerechnet worden. Also von daher haben wir den Schulen immer gesagt: ‚Wir sind auch da.‘ Unsere Turnhalle wird vormittags von Grund- und Realschulen genutzt, auch da sind Verbindungen zum Sport da, und durch den Ogata sind die natürlich generell gut.
Ich habe mich damals geweigert, ein Fitnessstudio zu machen. Ich hatte lange mit der Frau Schwarze Kontakt. Die war ja damals Vorsitzende vom Deutschen Studioverband oder so ähnlich hieß der. Ihr habe ich gesagt: ‚Fitnessstudio finde ich nicht in Ordnung.‘ Wir haben es dann Sportstudio genannt. Das waren so die ersten, die im Sportbereich auf den Weg kamen, wo natürlich die kommerziellen Studios ja sehr stark auch gegen gewettert haben, obwohl man dann das System nicht verstanden hat. Wir haben gesagt: ‚Wir stecken das Geld ja wieder in den Sport.‘ Dieses Geld braucht man nämlich zum Leistungssport.
Also wenn ich sehe, was das Studio erwirtschaftet. Das ganze Geld geht also fast in den Leistungssport, weil da die Kosten enorm gestiegen sind. Und natürlich geht das Geld auch zum Teil in den Breitensport, aber überwiegend in den Leistungssport.
Wir haben damals angefangen und mit 800 Leuten kalkuliert, das waren ganz schnell viel mehr. Also das ist ein Standbein im Verein, ohne das könnte man nicht das machen, was man heute machen kann.
Angefangen hat die Idee mit dem Fitnessstudio folgendermaßen: Die Idee kam aus dem Sportmanagement, also von der Marion Weißhoff-Günther. Die Diplom-Sportlehrer, die von der Hochschule kamen, haben ja eine ganz tolle Chance gehabt, sich ihr Berufsfeld selber aufzubauen. Die kamen ja ins Nichts, sag ich jetzt mal, und haben dann angefangen, sich zu entwickeln, haben ein tolles Netzwerk gehabt. Und aus diesem Netzwerk heraus sind auch diese Gedanken entstanden. Also da war ich nicht beteiligt als Ideengeber, sondern ausschließlich durch Sport oder auch alle anderen, die sonst in der Redaktion waren.
Da kam also die Idee: Wir sollten ein Sportstudio entwickeln, und zwar zunächst mal andere Geräte, aber auch die Möglichkeit schaffen, der Gesellschaft angepasst, dass nicht jeder zu einer bestimmten Stunde Zeit hat, um Sport zu treiben. Sondern ich kann morgens gehen, ich habe Zeit, ich kann nachmittags gehen oder ich habe abends Zeit. Dann kamen die Gedanken: Ja, aber die wollen doch Gruppen? Der Verein hat doch diese Vereinsphilosophie, dass man miteinander etwas macht. Also das war so das Gegenstück zu dem freien Sporttreiben im Sportstudio. Aber trotzdem haben wir dann gesagt, an dieser Entwicklung muss man festhalten, und dieses individuelle Sporttreiben muss einfach sein. Und da muss man es auch spannend machen. Und da gab es ja diese Geräte, ich glaube, aus München kamen die, die mit einem sprachen: ‚Hallo, bist du wieder da?‘
Das war ja eine tolle Zeit. Und was sich entwickelt hat, dass es auch da wieder Gruppen gibt, die sich nämlich um 6:00 Uhr oder um 8:00 Uhr treffen, keine 20 in der Halle, aber fünf, sechs, sieben, wie auch immer. Also das war so die Entwicklung der Gesellschaft angepasst.
Die jungen Sportwissenschaftler haben gute Arbeit geleistet, muss ich sagen, in diesem Netzwerk. Dadurch sind wir dann ja auch zum Freiburger Kreis gekommen, weil dieses Netzwerk einfach bestand und die Sportmanager das sind die heutigen Geschäftsführer und Vorsitzenden. Ich fand das toll, mit welchem Engagement sie diese Zeit genutzt haben, den Sport in den Vereinen vorwärts zu kriegen. Das hätte man alleine am Schreibtisch vor sich hindenkend gar nicht schaffen können. Also diese Entwicklung, wenn heute einer die Position übernimmt, der kriegt ein gemachtes Arbeitsfeld. Aber dieses reiche Wissen, was da entwickelt worden ist, welches die ja mitnehmen, das fand ich einfach toll. Wer hat schon diese Chance gehabt?
Und das hat Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Also diese Arbeit, auch wenn es viel Arbeit war. Ich weiß gar nicht, wie ich das manchmal gemacht habe. Ich habe ja auch einen Vollzeitjob gehabt. Ich habe 40 Stunden gearbeitet. Und dann war auch noch die Politik dabei. Aber es war toll, es hat sich was bewegt, es waren Ideen da, und man hatte Möglichkeiten gesucht, was umzusetzen oder auch fallen zu lassen. Es war toll. Also die, die jetzt kommen, können das auch toll machen. Aber sie haben schon mal was vorgegeben, wo sie rein müssen. Das war damals einfach eine tolle Zeit. Eröffnet wurde das Studio 1989.“ -
… die Akquise hauptamtlicher Mitarbeiter
„Der Vorstand sah eigentlich gar keine andere Wahl, wenn er den Verein vorwärtssteuern will. Alle haben erkannt, dass es so nicht geht. Also, irgendwas muss jetzt passieren. Und dann meckerten auch manchmal die Abteilungsleiter, dass sie auch nicht mehr alles konnten und auch nicht wussten, an wen sie sich wenden sollten. Dann kam ja auch die Verbandspolitik dazu, das Meldewesen bei Veranstaltungen und Wettkämpfen und so, und dann ist entschieden worden: ‚Wir müssen das jetzt hauptberuflich und zwar mit einer Fachkraft, mit gut ausgebildeten Diplom-Sportlehrern, besetzen.‘
Da haben wir die Stelle ausgeschrieben beim Arbeitsamt. Alle anderen, die dazugekommen sind, auch übers Arbeitsamt, sonst hätte man keine ABM-Maßnahmen erhalten, aber da kannte man sich. Das ist dieses, wer kennt wen? Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, und er meldet sich dann beim Arbeitsamt und meldet sich da arbeitslos. Sie waren ja auch arbeitslos, und dann konnte man vermittelt werden. Das war der Einstieg, am Anfang waren es drei. Einer davon ist dann ganz schnell wieder gegangen, weil er doch nicht in die Vereinsphilosophie passte. Es muss im Vorstand und auf der hauptberuflichen Ebene passen. Da muss man sich auch mal trennen, wenn einer nicht passt. Weil nur dann, wenn dieser Kreis funktioniert, kann es erfolgreich sein. Wenn die gegeneinander arbeiten, wenn sie einen haben, der immer so hintenrum muffelt. Oder einen haben wir rausgeschmissen, der hat Sportstunden aufgeschrieben, die er gar nicht gemacht hat. Da ist man ein Betrieb, da ist man Unternehmer, da ist man Arbeitgeber, und dann schmeißt man raus. Das ist genauso wie in jedem anderen Beruf auch.
Und das muss man auch tun, dann darf man nicht denken: ‚Ach, du lieber Himmel!‘ Und ich bin im Verein und der Verein macht das nicht. Also, wenn man so anfängt, dann kann man nicht arbeiten. Also, man muss gucken, dass diese Ebene funktioniert. Und wenn da einer muffelt, dann muss man gucken, weshalb, wieso, warum ist das so? Es gibt ja auch Gruppen, die keinen reinlassen. Also, ich meine, auch das gibt es auf der Ebene. Wenn ich fünf hauptberufliche Mitarbeiter habe, kommt der sechste und die wollen den nicht, da macht man gar nix, da wollen die den nicht, und dann muss man gucken, was ist mir wichtiger. Also, das ist Arbeitgeberaufgabe.
Aber gefunden wurden die hauptamtlichen Mitarbeiter meistens durch Netzwerke. Also, die ersten ABM-Maßnahmen ja, dann hat man jemanden gesucht, und dann gab es hier die Plattform der Sporthochschule, da wurde dann ein Aushang gemacht. Das war nicht so schwer, da waren ja auch viele, die einen Job gesucht haben. Also, irgendwie möchte man ja mit dem, was man gemacht hat, auch arbeiten, entweder in der Praxis oder im Management. Das war die Entwicklung, und die war einfach toll zu der Zeit. Ich glaube, heute ist es schon schwieriger, eine gute Kraft zu kriegen, weil alle irgendwie versorgt sind oder wissen, wohin die gehen. Oder ich weiß es nicht genau, ich bin da außen vor.
Aber man muss schon wissen, was man will und wo man es machen kann. Ich glaube, dass der Arbeitsmarkt für Sportwissenschaftler sehr bunt ist.
Also so war das, dass man dann Leute gekriegt hat. Man hat immer ein Team, was funktionieren muss, und das gilt auch für die Entwicklung. Als wir angefangen haben zu überlegen: Wie kriegen wir unseren Verein überzeugt, dass kein ehrenamtlicher Vorstand mehr da ist? Das waren zwei Jahre Arbeit.
Ich habe mit allen Abteilungen gesprochen. Ich habe mir dann den Dieter Rehm von Rheine geholt, die hatten das gerade gemacht. ‚Erzähl du mal unseren Leuten, wie das bei euch gelaufen ist.‘ Und so kriegt man das hin, dass die sagen, die Idee ist doch gut und das auch mitgetragen haben, dann braucht er ja ein Präsidium, und wen nimmt man da rein, und was machen die? Und viel Arbeit hat das Präsidium eigentlich nicht, soll es auch gar nicht haben, weil der Vorstand ja arbeiten muss.
Also, das muss man alles hinbiegen, und da muss man die Satzung ändern, eine komplette neue Satzung machen. Ja, und dann hat man es geschafft, dann kann man sagen, genau so geht das.“
Organisation von Schwimmwettkämpfen im analogen Zeitalter
Hauptberuflichkeit als Grundlage der Vereinsentwicklung
Eigenengagement als Wachstumsbedingung
Verhältnis zu DOSB und LSB
Die Professionalisierung des Vorstands
Hier finden Sie in Kürze das vollständige Interview im PDF-Format: