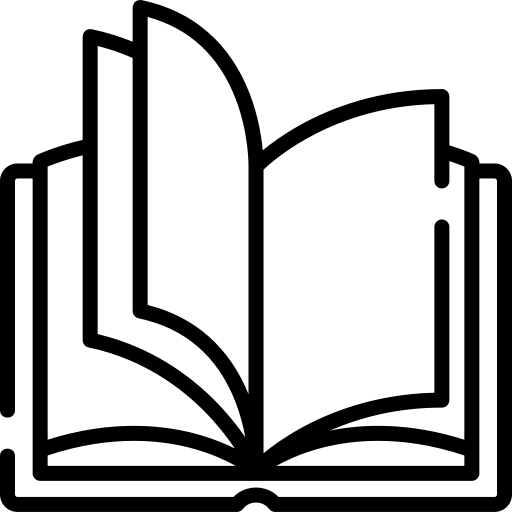Josef “Jupp” Kompalla
Josef “Jupp” Kompalla
*1936
Legendärer Eishockey Schiedsrichter
Jupp Kompalla vollzog den Wandel vom raubeinigen Verteidiger bei Preußen Krefeld zum weltweit anerkannten Schiedsrichter. Seine Souveränität und charismatische Art verhalf ihm zu Einsätzen bei 9 A-Weltmeisterschaften sowie der sogenannten Summit Series zwischen Kanada und der UdSSR 1972 und 1974 – sowie zu einer gemeinsamen Zigarre mit Leonid Breschnew.
Kurzbiografie
- Geboren 1939 in Kattowitz
- 1950er-Jahre Jugendspieler bei Gwardia Kattowitz
- 1958 Polnischer Eishockeymeister
- 1958 Übersiedlung nach Krefeld
- 1958-1969 Spieler bei Preußen Krefeld
- Ab den 1960er-Jahren stand Kompalla im Dienste der Stadt Krefeld
- 1972-1986 Schiedsrichter bei insg. neun A-Weltmeisterschaften; Vergleichsspielen Kanada vs. UdSSR 1972 und 1974
- 1976, 1980 und 1984 Schiedsrichter bei den Olympischen Spielen
- 1997-2006 Mitglied im Schiedsrichterausschuss des DEB
- Seit 2003 Mitglied der IIHF Hall of Fame
Jupp Kompalla über …
-
… seine Kindheit in Polen und Anfänge in Krefeld
„Wir wollten aussiedeln aus Polen nach Deutschland, weil wir Deutsche waren. Ich bin im Kindergarten, erste, zweite und dritte Klasse, in die deutsche Schule gegangen. Und dann kam Polen und ich bin sitzen geblieben, weil ich kein Wort Polnisch sprach. Wir haben zu Hause immer Deutsch gesprochen. Und mein Vater hat gesagt, wenn ich was auf Polnisch sagte: ‚Zuhause wird Deutsch gesprochen!‘ Und Gott sei Dank habe ich das gemacht. Und Russisch habe ich in Polen gelernt. Jeden Tag war eine Stunde in der Schule Russisch. Ich habe gesagt: ‚Will ich nicht!‘ Dann kam die Lehrerin und sagte: ‚Hinter die Tür!‘ Und dann, nach einem halben Jahr, hat sie zu meiner Mutter gesagt: ‚Wenn der Kompalla sich in Russisch nicht verbessert, kommt er nicht weiter.‘ Und dann habe ich gepaukt und dann bin ich weitergekommen, und das kam mir im Sport unheimlich zugute.
In Deutschland hat mir der Verein Preußen Krefeld Arbeit besorgt. Ich bin gelernter Autoschlosser. Das hab ich nicht verbunden, weil ich so viel wegmusste, wegen der Spiele. Und da haben sie gefragt: ‚Wollen sie Eishockey spielen oder arbeiten?‘ Da habe ich gesagt: ‚Ich will Eishockey spielen.‘ Damals gab es ja kein Geld. Das habe ich nebenbei alles gemacht. Früher habe ich gearbeitet. Abends war ich Barkeeper in einem Nachtlokal in Krefeld. Der Chef war ein begeisterter Eishockey-Fan. Und dann habe ich das Angebot bekommen, nach Südafrika zu gehen. Und dann habe ich gesagt: ‚Ich gehe ein halbes Jahr nach Südafrika.‘ Als ich zurückgekommen bin, habe ich mir etwas anderes gesucht, bei der Stadt.“ -
… den Startschuss für die Karriere als Schiedsrichter
„1968 bin ich zu den Olympischen Spielen nach Grenoble als Zuschauer gefahren. Dort war ein deutscher Schiedsrichter, den habe ich angeguckt. Ich bin dann mit dem Auto zurück. In der Gaststätte dort in Krefeld war ein Lehrgang. Und da sagt der Schiedsrichter Obmann: ‚Komm doch zum Schiedsrichterlehrgang. Du brauchst keine Tests machen. Praxis, Schlittschuhlaufen und Theorie kannst du alles.‘ Da habe ich mich überreden lassen. Dort waren so 30 oder 20 Teilnehmer damals und ich habe dann bestanden. Nun, dann habe ich meine ersten Spiele bekommen. Erst Knaben, Schüler und so. Und dann sagte ich, ich war 33: ‚Nein, ich spiele noch weiter Eishockey.‘ Da hat mir damals der Obmann aus Landshut, Herr Zeller, einen Brief geschrieben: Jupp, wir haben dich beobachtet. Du hast das Zeug. Spielen kannst du vielleicht noch zwei Jahre. Wie wäre es als Schiedsrichter?
Da bin ich mal einen Abend im Park gesessen und habe überlegt: Spielen oder Schiedsrichter? Dann habe ich mich entschieden. Ach, mache ich Schiedsrichter. Dann habe ich zugesagt, das war 1970. Und dann habe ich immer schon Juniorenspiele bekommen, dann Regionalliga und 1970 kriegte ich meine internationale Lizenz und habe Europacup gepfiffen.Und 1972 kriege ich ein Schreiben vom internationalen Verband. Die Deutschen haben mich eingeladen zur Weltmeisterschaft nach Prag, A-Gruppe. Ich dachte, sind die verrückt geworden? A-Gruppe? Das waren ja nur zwölf Hauptschiedsrichter mit Linesmen. Ich sage: ‚Ich fahre mal hin.‘ Dann habe ich beim ersten Spiel die Scheibe eingeworfen, da zittern mir die Knie. Nun, dann habe ich mich da durchgeschlagen. Der Spiegel schrieb damals: Der Senkrechtstarter aus Krefeld. Ich habe zwölf Spiele, die meisten Spiele gepfiffen. Prag war praktisch mein Start.
1972 wurde ich nach Kanada eingeladen. Da waren damals die Spiele Russland, Kanada, die Profis, die Spiele des Jahrhunderts. Vier Spiele in Kanada und vier Spiele in Moskau. Da bin ich nach Kanada. Dort sind wir 14 Tage vorher hingefahren, haben am Lehrgang teilgenommen und sie haben uns gedrillt. Dann habe ich mein erstes Spiel gepfiffen in Québec. Beim Face-off gab mir die Scheibe damals der Präsident Trudeau. Dann habe ich eingeworfen, und dann bin ich von Québec nach Ottawa. Dann nach Winnipeg und dann nach Edmonton. Und dann habe ich zwei Exhibition-Games gepfiffen, zwischen zwei kanadischen Mannschaften. In Saskatoon und in Regina. Dann waren wir in Vancouver. Und dann sind wir zurückgeflogen nach Stockholm. Dort habe ich zwei Spiele gepfiffen: Schweden-Kanada in Stockholm. Von dort aus sind wir nach Moskau geflogen. Und in Moskau, bei allen vier Spielen, habe ich das entscheidende Spiel gepfiffen, wo die Kanadier gewonnen haben. Die haben die Serie gewonnen. Da gib es ein berühmtes Bild. Ich stehe als Schiedsrichter vor dem Spieler. Der Spieler will auf mich losgehen mit dem Schläger. Aber er hat nicht zugeschlagen. Und dann war da ein Palaver. Der kanadische Trainer hat die Bank aufs Eis geworfen und ich habe gesagt: ‚Spielt ihr jetzt weiter oder was? Die ganze Welt schaut zu!‘ Das waren die russischen Profis und die Amerikaner, die besten Spieler.“
-
… die Lex Kompalla in Krefeld
Für Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften hat mich die Stadt bezahlt freigestellt. Und außerdem habe ich noch dreißig Tage Urlaub gehabt. Die haben gesagt: ‚Du hast eine Lex Kompalla.‘ Ich habe im Sportamt gearbeitet. Bis ein Uhr am Mittag am Eis, jeden Tag. Darum brauchte ich auch nicht so viel trainieren, weil ich jeden Tag am Eis war. Und am Nachmittag war ich beim Sport. Dann habe ich Tennis gemacht, dann bin ich zum Tennisturnier. Oder etwas, was mit Schulsport zu tun hat, Basketball oder so.“
-
… eine Zigarre mit Breschnew
„Ich habe bei der Weltmeisterschaft in Sankt Petersburg früher zum Beispiel mit Putin gesprochen. Er hat gesagt: ‚Wir kennen uns. Ich habe Sie gesehen, im Fernsehen.‘ Er spricht sehr gut Deutsch, der Putin. Und zu Breschnew, da wollte ich erzählen: Wir wollten zur Besichtigung, zum Kreml und zum Mausoleum. Das war nicht immer offen, es war zu. Aber vom russischen Sport haben die gesagt: ‚Wir machen das klar mit dir.‘ Der Kreml, der ganze Platz. Ich ging mit einem Soldaten zum Mausoleum. Und da habe ich Lenin gesehen, Stalin hat da auch gelegen. Und dann zurück. Und einmal war ich beim Iswestija-Cup. Da war der Breschnew vorher gestorben. Ich habe ein Jahr vorher mit Breschnew auf der Tribüne, als ich frei hatte, mit ihm eine Zigarre geraucht im Luschniki-Palast. Und ein Jahr, zwei Jahre, später, da war er tot. Da war ich ja auch in Moskau. Ich wollte zum Grab. Weil er dort in der Mauer war. ‚Nun ja, machen wir.‘ Dann bin ich gefahren, mit dem Polizisten zum Mausoleum. Noch alleine am Grab wollte ich fotografieren. Da sagt er: ‚Geht nicht, da sind alles Kameras. Kann ich nicht.‘ Und dann trug ich den Mantel von den Olympischen Spielen mit dem Bundesadler. Und wie ich zurückgekommen bin, durch die Zäune, sagen deutsche Touristen: ‚Kompalla müsste man heißen, dann kommt man überall rein.‘“
-
… Eigenschaften eines erfolgreichen Schiedsrichters
„Ich bin damit zufrieden, was ich in meinem Leben erreicht habe. Man muss mit dem Herzen dabei sein. Man muss jede Aktion verarbeiten und auch aus Fehlern lernen. Wenn ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin, dann bin ich das Spiel im Kopf noch einmal durchgegangen: Warst du zu kleinlich, zu großzügig? Ich habe auch meine Linesmen gefragt: ‚Habt ihr etwas gesehen? Und wenn da was war, dann meldet euch.‘ Ich habe das ja nicht alleine gemacht. Ich habe ja noch Leute, die mir helfen. Ich bin nicht der Kompalla. Ich habe ja noch zwei, die zu meinem Gespann zählen. Wenn die Mist sind, bin ich auch Mist. Ich habe die auch gelobt in der Kabine im Drittel: ‚Gut gemacht!‘ Oder: ‚Das hast du dort nicht gesehen.‘
Ich hatte wenig mit den Offiziellen zu tun. Wenn jemand mich sprechen wollte, dann habe ich gesagt: ‚Bitte nicht. Nach dem Spiel.‘ Und dasselbe, wenn ein Trainer beim Spiel mich sprechen wollte, dann habe ich gesagt: ‚Später können sie mich sprechen.‘ Denn in dem Moment hat der Wut. Dann hätte er mir was gesagt. Und dann, eine Viertelstunde später, dann sagt er: ‚Nee, es war nichts.‘ Man muss nicht, wo es brennt, noch Feuer reingeben. Man muss löschen. Eishockey, das ist ein Kampfsport, das sind Kämpfer. Die haben eine Waffe, die Schläger, Verletzungen und so. Gut, die Regeln sind jetzt ein bisschen strenger geworden und auch gefährlicher durch die Plastikscheiben. Früher prallte einer gegen die Bande, da ging der Kopf noch rüber und nichts war. Und heute, wenn er dagegen prallt, dann prallt der gegen Plastik und gegen die Wirbelsäule. Es ist schon gefährlich. Man muss immer sagen: Die haben eine Waffe. Beim Fußball, das sind die Spinner. Die fallen wie die Fliegen und haben nichts. Dafür müsste man Gelb zeigen. Gut, beim Fußball wurde durch Video mit dem Abseits geholfen. Aber vielleicht brauchen wir in zehn, zwanzig Jahren keine Schiedsrichter mehr. Alles machen Computer. Oder es sitzt einer oben, der kriegt einen Impuls im Gehirn, wenn es Foulspiel ist.“
-
… Haare im Wind und lange Autofahrten
„Mein Vater spielte Handball. Das wusste ich von Erzählungen. Der war ganz stolz, dass ich Eishockey spielte. Der hat sich hinter der Bande manchmal mit Leuten gezankt. Ich habe ihm gesagt: ‚Wenn du noch mal zum Spiel kommst, dann hältst du die Klappe und zankst dich dort nicht rum!‘ Früher gab es ja kein Plastik, nur so Drahtnetze herum. Aber er war ganz stolz auf mich, wie ich die erste Weltmeisterschaft gepfiffen habe. Da hatte mir Mutter erzählt, dass sie extra einen Fernseher gekauft haben, weil ich dort in Prag zwölf Spiele gepfiffen habe. Das war mein internationaler Grundstein.
Wir pfiffen auch früher ohne Helme. Das war das Schöne, der Wind, Frisur, kurze Haare. Heute Panzer und Plastik. Heute wissen sie gar nicht, wer pfeift. Früher hatten wir Namen hinten gehabt und Nummern. Ich habe mit der IIHF telefoniert. Die hatten einen Guide rausgebracht und letztens bin ich da noch mit den meisten internationalen Turnieren. Aber ich bin auf dem Teppich geblieben. Ich habe mich immer gefreut auf das nächste Spiel. Ich habe Menschen dadurch kennengelernt, Städte in Deutschland und überall. Es gibt Leute, die kennen nur Krefeld und nichts weiter. Die waren nicht in Berlin, die waren nicht in Frankfurt, nicht in Hamburg.
Manchmal, um Geld zu sparen, habe ich im Auto geschlafen. Ich bin auf der Autobahn gefahren, Raststätte raus und Nickerchen gemacht. Oder wenn ich kaputt war, dann bin ich auch mal mit dem vorderen Reifen an die Leitplanken. Also auch ein bisschen müde. Ich habe manchmal gearbeitet, dann abends zu Spielen nach Landshut. 600 Kilometer nach Landshut, Spiel gepfiffen, Tasse Kaffee und 600 zurück und dann wieder zur Arbeit.“
Von Kattowitz nach Krefeld
Trainer- oder Schiedsrichtertätigkeit?!
Summit Series 1972
Erfolgsrezept á la Kompalla
Hier finden Sie in Kürze das vollständige Interview im PDF-Format: